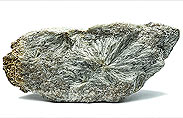Lage
Das Fichtelgebirge befindet sich im Nordosten Bayerns und umfasst Teile von Oberfranken und der Oberpfalz. Es reicht bis nach Tschechien. Das Hohe Fichtelgebirge umschließt hufeisenförmig die Selb-Wunsiedler-Hochfläche, die manchmal auch als „Inneres Fichtelgebirge“ bezeichnet wird. Der höchste Berg ist der 1051 Meter hohe Schneeberg westlich von Wunsiedel. Auf dem Gipfel steht der ehemalige Fernmeldeturm der Bundeswehr als Zeugnis aus dem Kalten Krieg. Der berühmte Steinbruch Zufurt befindet sich hinter Tröstau an der Bergkette, die bis zum Schneeberg reicht. Nur wenig daneben etwas weiter oben liegen gut versteckt im Wald die alten Steinbrüche auf der Gemarkung Fuchsbau oberhalb von Leupoldsdorf. Der markante Epprechtstein mit seiner alten Burgruine und den zahlreichen Steinbrüchen befindet sich etwa 12 Kilometer nördlich von Wunsiedel bei Kirchenlamitz. Nur wenige Kilometer südlich des Epprechtsteins gelangt man zu einem Wäldchen mit der aufgelassenen Uranerzgrube Christa bei Großschloppen. Die ehemalige Specksteingrube Johanneszeche bei Göpfersgrün liegt zwischen Wunsiedel und Thiersheim auf der Selb-Wunsiedler-Hochfläche. Den Steinbruch Köhlerloh am Waldstein findet man am westlichen Rand des Fichtelgebirges. Der Steinbruch am Teichelberg bei Pechbrunn befindet sich im Steinwald.
Epprechtstein
Im Fichtelgebirge kommen verschiedene Granitsorten vor. Bei der Erstarrung der magmatischen Gesteinsschmelzen lagerten sich Erze der Metalle wie Bor, Lithium, Thorium, Uran oder Zinn in Drusen und Spalten ab. Der Zinnbergbau wird 1356 erstmals erwähnt. Zeugnisse davon finden sich bei der Gemarkung „Pechlohe", wo heute noch zu sehende „Zinngräben“ auf die einstige Erzwäsche aus den Zinnseifen hinweisen. Die Burgruine auf dem Epprechtstein stammt aus dem Mittelalter, sie wird 1248 erstmals als „Eckebretstein“ erwähnt. Damals verwendete man den Granit hauptsächlich aus Findlingen. Bis 1721 wurde am Epprechtstein Granit wild abgebaut. Ab 1724 durften nur noch berechtigte Steinmetzmeister Granit abbauen. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden die großen Steinbrüche. Der Bau der Eisenbahn direkt an den Epprechtstein trug dazu bei, dass der Verkauf des Granits aus den Steinbrüchen sehr ertragreich wurde. Der Granit diente zum Brücken- oder zum Hausbau, er wurde aber auch für Denkmäler, Grabsteine oder Brunnen benötigt. Insgesamt waren einmal 20 Steinbrüche in Betrieb, heute ist es vor allem der Schlossbrunnenbruch, der als größter Steinbruch noch aktiv ist. Der Gipfel des Epprechtsteins gilt schon seit 1938 als Naturdenkmal, seit 1990 untersteht das gesamte Gebiet dem Landschaftsschutz.
Insbesondere im Schlossbrunnenbruch wurden schöne Mineralienstufen gefunden, zum Beispiel Feldspat wie Albit und Orthoklas, bläulichen Fluor-Apatit, Fluorit, Muskovit, Rauchquarz und dunkler Turmalin, oder auch Stücke für den Micromounter, zum Beispiel der Bertrandit oder vielflächiger, klarer Goyazit. Das Beryllium-Aluminium-Silicat Euklas bildet blockig-prismatische Kristalle, die die typischen Streifungen und gerundete Kopfflächen zeigen. Kristalle des Zinnminerals Kassiterit sind eher selten, weil dieses überwiegend als körniger „Zinnstein“ im Zinngranit oder als Ablagerungen in den Bächen als „Zinnseifen“ enthalten ist. Als „Zinnwaldit“ bezeichnet man eine Serie von Glimmern (ohne konkreten Mineralstatus), die zwischen dem Siderophyllit und dem Polylithionit eingeordnet sind. Sie zählen nicht zu den Zinnerzen, der Name ist nach dem tschechischen Ort Zinnwald (Cínovec) abgeleitet. Auch Uranminerale wie Autunit oder Metatorbernit kommen am Epprechtstein vor.

Fluor-Apatit
Epprechtstein

Fluor-Apatit, Schörl
Epprechtstein

Bertrandit
Epprechtstein

Euklas (von vorne)
Epprechtstein

Euklas (von der Seite)
Epprechtstein
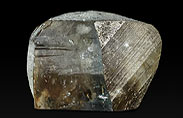
Euklas
Epprechtstein

Euklas
Epprechtstein

Fluorit
Epprechtstein

Goyazit, Turmalin
Epprechtstein

Kassiterit
Epprechtstein

Metatorbernit
Epprechtstein

Rauchquarz
Epprechtstein

Rauchquarz, Feldspat
Epprechtstein

Turmalin
Epprechtstein

Zinnwaldit
Epprechtstein
Grube Christa bei Großschloppen
Nur ein paar Kilometer südwestlich vom Epprechtstein liegt bei Großschloppen, einem Gemeindeteil von Kirchenlamitz, die Uranlagerstätte der ehemaligen Grube Christa. Der Beginn des versuchsweisen Abbaus erfolgte 1979, gefördert wurde vor allem Pechblende aus dem unterirdischen Erzgang. Dazu legte man einen wendelartigen Tunnel mit abzweigenden Gängen bis in eine Tiefe von 195 Meter an. Im Jahr 1987 wurden das Projekt beendet und die Böden renaturiert. Vom Stolleneingang, den Halden und dem Untertagebau ist nichts mehr sichtbar. Der Wald ist aufgeforstet, so dass heute alles bewachsen ist. Das Wäldchen mit der ehemaligen Grube befindet sich einen halben Kilometer östlich von Großschloppen. Am Waldrand befindet sich die Sandgrube, in der früher an einer Quarzbank Quarzkristalle gefunden wurden.
Die granitische Ganglagerstätte der Grube Christa mit den enthaltenen Uranerzen ist etwa einen Kilometer lang und 30 bis 60 Meter dick. Bis zu 2500 Tonnen Uranerz werden in der Lagerstätte vermutet. Aus der Grube stammen Uranminerale wie Saléeit, Phosphuranylit, Torbernit und Metatorbernit, Uraninit, Uranophan oder sogar der seltene Wölsendorfit. Es sind auch wunderschöne Paragenesen von violettem Fluorit mit grünem Epidot bekannt. Der Fluorit kann perfekte Oktaeder ausbilden.

Epidot, Fluorit
Grube Christa

Fluorit, Epidot
Grube Christa

Saléeit
Grube Christa

Torbernit, Saléeit
Grube Christa

Uranophan
Grube Christa
Steinbruch Zufurt bei Tröstau
Der Steinbruch Zufurt befindet sich hinter Tröstau am südöstlichen Ende des Schneebergzugs. Er besteht aus hellgrauem Zinngranit oder aus dunkelgrauem Randgranit mit hellem Feldspat. Die interessanten Minerale stammen aus Pegmatitlinsen oder aus Klüften des Zinngranits. Der Steinbruch lieferte ähnliche Paragenesen wie am Epprechtstein, so dass eine Unterscheidung oft schwierig ist. Bei einer Sprengung im Jahr 1988 wurde von einem Mitarbeiter in einer großen Druse ein Jahrhundertfund mit riesigen Quarzkristallen und anderen einmalig ausgeprägten Mineralienstufen gemacht. Im Steinbruch ist heute das Sammeln von Mineralien verboten, die Stellen mit den Pegmatitlinsen werden auch nicht mehr bearbeitet, so dass keine Fundmöglichkeiten mehr bestehen.
Aus den Pegmatitlinsen stammen zum Beispiel Bergkristall und Rauchquarz – auch in großen Kristallen – sowie Albit, Fluor-Apatit, Bertrandit, Euklas, Orthoklas oder Topas. Eine Rarität ist das Calcium-Beryllium-Mineral Herderit, das klare Einzelkristalle und manchmal auch Zwillinge ausbildet. In den Klüften können diese Minerale enthalten sein: Anatas und Rutil, Hämatit, Phenakit, Pyrit, Quarz in kleineren Kristallen, Metatorbernit und Torbernit, Muskovit, Sphalerit, Stibnit, Stilbit oder Zirkon. Der Fluorit kommt zusammen mit Quarz im Episyenit vor, einem Gestein, das in den Granitgängen vorhanden ist. Im Episyenit ist der Quarzgehalt vermindert, er ist dafür mit Albit angereichert. Auch Sekundärbildungen aus dem Steinbruch sind bekannt, zum Beispiel Brochantit, Mimetesit oder Langit.

Albit, Rauchquarz
Steinbruch Zufurt

Anatas
Steinbruch Zufurt

Fluor-Apatit
Steinbruch Zufurt

Bertrandit
Steinbruch Zufurt

Hämatit
Steinbruch Zufurt

Herderit
Steinbruch Zufurt

Herderit Zwilling
Steinbruch Zufurt

Metatorbernit
Steinbruch Zufurt

Mimetesit
Steinbruch Zufurt

Muskovit
Steinbruch Zufurt

Orthoklas
Steinbruch Zufurt

Phenakit
Steinbruch Zufurt

Pyrit
Steinbruch Zufurt

Quarz
Steinbruch Zufurt

Rutil
Steinbruch Zufurt

Sphalerit
Steinbruch Zufurt

Stilbit
Steinbruch Zufurt

Zirkon
Steinbruch Zufurt
Steinbrüche am Fuchsbau bei Leupoldsdorf
Die Steinbrüche bei der Gemarkung Fuchsbau bei Leupoldsdorf waren von 1894 bis 1977 in Betrieb. Sie wurden von der Staatsforstverwaltung an Unternehmen verpachtet und unterlagen nicht den Abbaurechten des Markgrafen von Bayreuth. Bis in die 1990er-Jahre konnte man an den Steinbrüchen noch Mineralien suchen, aus dieser Zeit stammen die Funde. Danach wurden sie komplett unter Naturschutz gestellt. Der berühmte Topasfelsen ist nur noch schwierig zu finden: Er befindet sich hinter einem tiefen Biotop am geologischen Lehrpfad Nummer 7.
Am Lehrpfad befindet sich an einer Stelle eine Infotafel, wo Spuren der Zinnhänge zu erahnen sind: Dort gewann man ab dem Mittelalter Zinn. Bei der Verwitterung und Auswaschung des Zinngranits konzentrierte sich das Zinnerz als Sand oder als „Zinnseife“ entlang der Bachläufe. Der Sand wurde aufgehackt und in den fließenden Bach geworfen. Ein Bergmann wühlte das Sediment mit einer Seifengabel auf, dabei sanken die schweren Zinnerzkörner schneller an den Boden als das restliche Material. In mehreren Stufen wurde das Zinnerz im Bach so konzentriert. Die hügeligen „Zinnhänge“ entstanden durch das zurückbleibende Geröll, das man aus dem Bach seitlich entnahm. Beim bergmännischen Abbau aus einem Felsen wurde der Zinngranit abgehauen und danach zerkleinert. Zur weiteren Anreicherung des Erzes betrieb man Zinnerzmühlen, in denen das Material mit einem Pochwerk weiter zerkleinert wurde. In den Steinbrüchen am Fuchsbau kommen ähnliche Minerale wie im Steinbruch Zufurt vor, zum Beispiel Anatas, Fluor-Apatit, Goyazit, Kassiterit, Rauchquarz, Topas oder Torbernit. Auch Zinnwaldit wurde gefunden. Eine Rarität ist Cyrilovit in winzigen, gelben Pusteln.

Anatas
Fuchsbau

Fluor-Apatit
Fuchsbau

Cyrilovit
Fuchsbau

Goyazit
Fuchsbau

Kassiterit
Fuchsbau

Rauchquarz
Fuchsbau

Topas
Fuchsbau

Torbernit
Fuchsbau

Zinnwaldit
Fuchsbau
Wunsiedel, Johanneszeche
Der Steinbruch Ratskalkofen in Wunsiedel existiert nicht mehr, an der einstigen Fundstelle für Tremolit ist heute ein kleiner See und daneben ein Sportplatz. Die Johanneszeche bei Göpfersgrün liegt zwischen Wunsiedel und Thiersheim auf der Selb-Wunsiedler-Hochfläche, sie war früher eine Specksteingrube. An der ehemaligen Einfahrt steht eine Infotafel mit Informationen über die Geschichte und einem Luftbild zur Übersicht. Heute ist dort ein Biotop, das nicht mehr betreten werden darf, ein Einblick ohne Genehmigung ist praktisch unmöglich. Ein Speckstein ist ein Mischmineral, das als Hauptbestandteil Talk enthält. Er wird als Steatit bezeichnet, wenn er sich fettig anfühlt und gut bearbeiten lässt. Der Steatit aus der Johanneszeche tritt häufig pseudomorph nach Quarz oder nach Dolomit auf. Der Talk bildet nierenförmige oder kugelige Aggregate, er kann auch verästelte Mangan-Dendriten enthalten. Dolomit und Calcit, sowie Bergkristall, Rauchquarz und Amethyst stammen ebenfalls aus der Grube. Stern- und Artischockenquarze treten in typischen Wachstumsformen auf. Gelbgrüner bis blauer oder farbloser, gemeiner Beryll in hexagonalen Prismen und schwarzer Turmalin (Schörl) sind seltenere Funde aus dem Nordrand der Grube.
Steinbruch Köhlerloh am Waldstein
Auf der Westseite des Fichtelgebirges liegt der Steinbruch Köhlerloh am Waldstein auf der Gemarkung von Reinersreuth. Auch dort ist der Granit von Quarz und Pegmatitadern durchsetzt, in den Hohlräumen befinden sich die interessanten Minerale. Die Kristalle sind oft nur sehr klein, dafür hervorragend ausgebildet: Der Fluor-Apatit bildet farblose, gelbliche oder hellblaue Prismen, er sitzt gerne wie auch das schwarze Turmalinmineral Schörl auf dem Orthoklas. Der Steinbruch ist bekannt für gute Funde mit Albit, Anatas, Euklas, Phenakit oder Topas. Auf dem Quarz findet sich manchmal lattenartiges, cremeweißes Rhabdophan-(Ce). Auch gelber Cyrilovit kann in Kristallrasen auf dem Quarz sitzen. Der Fluorit kommt in kleinen, oft verzerrten Kristallen vor, die hellblau bis dunkelviolett zonar gefärbt sind.
Teichelberg bei Pechbrunn
Der Steinwald im Süden besteht ebenfalls aus Granit, im Süden und im Westen ist eine Basaltkuppe vorhanden. Besonders schön zu sehen ist das im Basalt-Steinbruch am Teichelberg bei Pechbrunn, wo Basalte und Tuffe auf dem Granit aufgesetzt sind. Im Steinbruch stehen geblieben ist ein Vulkanschlot, der aufgrund seiner Porosität nicht abgebaut wurde und in den Hohlräumen viele Minerale enthält. Im Steinbruch zu finden sind die typischen Minerale des Basalts wie langsäuliger Apatit, würfeliger Chabasit, oktaedrischer Gismondin, nadeliger Natrolith, Nephelin, kugeliger Hyalith, Phillipsit oder Thomsonit, sowie Augit und Diopsid. Der Montmorillonit kann pseudomorph nach Natrolith, Phillipsit oder anderen Mineralen auftreten, der Nontronit tritt pseudomorph nach Natrolith auf. Der Aragonit bildet spitze Nadeln, der Calcit tritt überwiegend rhomboedrisch oder auch in Vielkristallkugeln auf, manchmal auch in winzigen Skalenoedern. Arsenopyrit, Ilmenit, Magnetit in der Varietät Titanomagnetit, Markasit oder Pyrit kommen nur in winzigen Kristallen vor.

Basalt-Abbau
Stbr. Teichelberg

Vulkanschlot
Stbr. Teichelberg

Aragonit
Stbr. Teichelberg

Augit
Stbr. Teichelberg

Baryt
Stbr. Teichelberg

Kugel-Calcit
Stbr. Teichelberg

Calcit rhomboedrisch
Stbr. Teichelberg

Calcit skalenoedrisch
Stbr. Teichelberg

Chabasit-Ca
Stbr. Teichelberg

Diopsid, Natrolith
Stbr. Teichelberg

Hyalith, Montmorillonit
Stbr. Teichelberg

Pyrit, Natrolith
Stbr. Teichelberg

Natrolith
Stbr. Teichelberg

Nephelin, Apatit
Stbr. Teichelberg

Nontronit nach Natrolith
Stbr. Teichelberg

Phillipsit
Stbr. Teichelberg

Thomsonit-Ca
Stbr. Teichelberg
Alle Fotos: Thomas Seilnacht (außer Fotos 2x Köhlerloh und 2x Teichelberg: Manfred Früchtl)
Sammlung: Thomas Seilnacht (alle)
Finder der Minerale, bzw. ehemalige Sammlung: Max Kern (6), Manfred Früchtl (75), andere unbekannt