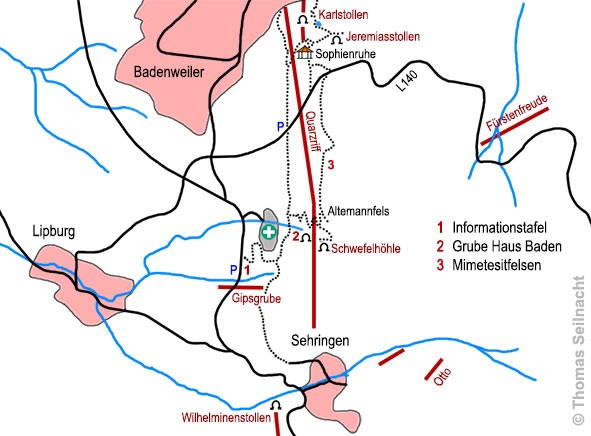Lage
Badenweiler liegt im Südwesten Deutschlands am Rand des Südschwarzwaldes. Man erreicht die Gemeinde von der oberrheinischen Tiefebene über das Städtchen Müllheim im Markgräflerland. Das ehemalige Bergbaugebiet erstreckt sich am Fuße des 1165 Meter hohen Blauens von den Ortsteilen Schweighof bis nach Lipburg-Sehringen.
Geschichte
Möglicherweise betrieben bereits die Römer Bergbau am Quarzriff bei Badenweiler am Westrand des Südschwarzwaldes. Der Quarz wurde beim Bau des Römischen Bades in Badenweiler benutzt. Relativ gesichert ist, dass der Abbau von silberhaltigem Bleiglanz und weiterer Bleierze ab dem Mittelalter erfolgte. Von 1747 bis 1967 wurde in der Gipsgrube Sehringen grobblättriger Gips abgebaut. Im 18. Jahrhundert wurde bei der Grube Haus Baden eine Erzwäsche, ein Pochwerk und eine Schmelzhütte betrieben.
Gruben und Halden
Das erzhaltige Quarzriff beginnt bei der Sophienruhe – einem wunderschönen Aussichtspunkt – und zieht sich bis nach Sehringen, es ist durch den Bergbau weitgehend abgebaut. Der Name „Blaue Halde“ unterhalb der Sophienruhe ist nach dem blauvioletten Fluorit benannt, der früher als Gangmineral häufig gefunden wurde. Etwas unterhalb der Sophienruhe findet sich gut versteckt im Wald der Eingang zum oberen Karlstollen, der schon im 15. Jahrhundert in Betrieb war. Der Katzenweiher oberhalb davon ist ein Beispiel für eine Einsenkung beim Stolleneinsturz. Hinter der Sophienruhe befindet sich der Eingang zum Jeremiasstollen.
Reste des Quarzriffs mit seinem harten Fels sind entlang des gut beschilderten Bergbau-Weges mehrfach zu sehen. Eine Hinweistafel am Standort „Quarzriff“ weist darauf hin, dass der Abbau direkt am Fels nicht mehr erlaubt ist. Ungefähr oberhalb der Klinik Haus Baden gelangt man zum Altemannfels mit der bergmännisch gebauten „Schlucht“. Im Mittelalter war das Feuersetzen in einem Hohlraum die gängigste Methode, um sehr hartes Gestein zu bezwingen: Das Gestein wurde stark erhitzt und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt. Rechts neben dem vergitterten Eingang zur Schwefelhöhle befindet sich ein solcher Hohlraum. Im Bergbau wird ein bergmännisch erstellter Hohlraum als „alter Mann“ bezeichnet, wenn er nicht mehr benutzt wird.
Weiter unterhalb befindet sich das Stollenmundloch der oberen Grube Haus Baden, im Wald darunter liegt die „Weiße Halde“. Nur wenig davon entfernt steht das Häuschen zum Wasserbehälter. 2009 und 2010 wurde dahinter ein Gang aufgeschlossen, der heute wieder eingestürzt ist. Von dort stammen die weltberühmten, orangegelben Mimetesit-Kugeln.
Im Revier Badenweiler gibt es noch weitere alte Gruben und Halden, auf denen ähnliche Paragenesen gefunden wurden. Die alte Halde der Grube Fürstenfreude liegt zum Beispiel weiter oben an der L140 Richtung Marzell. Von dort stammen Cerussit, Pyromorphit und vor allem Wulfenit in perfekt ausgebildeten Kristallen. Angliobaryt ist eine Barytvarietät, die Blei-Ionen enhält, der Übergang zum Anglesit ist fließend. Im Wilhelminenstollen (auch Wilhelminengrube) südlich von Sehringen wurden ebenfalls schön auskristallisierte Bleierze wie Anglesit, Cerussit, Mimetesit oder Pyromorphit gefunden. Eine absolute Rarität stellt der stäbchenförmige Pyrargyrit dar.
Exemplarische Auswahl vorkommender Minerale
Die unten abgebildete fast 20 Zentimeter große Druse mit Quarz wurde vom Autor als Kind in den 1970er-Jahren bei der Sophienruhe selbst gefunden. Aus dem Karlstollen stammt bläulicher, teils transparenter Baryt. Viele gute Funde wurden auf der Weißen Halde der Grube Haus Baden im Wald in Richtung Sehringen gemacht. Im Gestein überwiegen Quarz und Baryt, sowie etwas Chalkopyrit, Fluorit und derber Bleiglanz. In den Sammlungen befinden sich auch Minerale wie Anglesit, Cerussit, Covellin, Hemimorphit, Malachit, Mimetesit, Pyrit, Pyromorphit oder Wulfenit. Der Smithsonit bildet winzige, reiskornartige Kristalle, die auch spitz zulaufen können. Der Langit kann sich pseudomorph zu Brochantit umwandeln. Gut kristallisierte Zinkblende ist in Badenweiler selten. Eine Rarität stellt der Elyit vom Altemannfels dar. Er tritt zusammen mit weiteren Bleimineralen sekundär als Folge des Feuersetzbergbaus auf. Elyit kommt in violetten Nadeln vor und kann mit dem himmelblauen Blei-Kupfer-Erz Chenit vergesellschaftet sein. Zu diesem kann er sich auch durch eine Pseudomorphose umwandeln. Weitere Minerale der Feuersetzparagenese sind zum Beispiel Caledonit, Hydrocerussit, Lanarkit, Leadhillit, Linarit, Lithargit, Minium, Scotlandit, Susannit oder Woodwardit.
Fotos: Sophienruhe, Karlstollen, Quarzriff

Quarz
Sophienruhe

Angliobaryt, Mimetesit
Sophienruhe

Baryt
Oberer Karlstollen

Mimetesit
Karlstollen

Baryt, Mimetesit
Quarzriff

Mimetesit
Quarzriff
Grube Haus Baden und Wasserbehälter

Anglesit
Haus Baden

Bleiglanz
Haus Baden

Bleiglanz
Haus Baden

Cerussit
Haus Baden

Cerussit
Haus Baden

Covellin, Chalkopyrit
Haus Baden

Fluorit
Haus Baden

Fluorit, Baryt
Haus Baden
 Hemimorphit
HemimorphitHaus Baden

Langit
Haus Baden

Linarit
Haus Baden
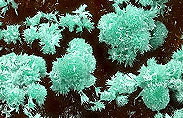
Malachit
Haus Baden

Pyromorphit
Haus Baden

Pyromorphit
Haus Baden

Pyromorphit
Haus Baden

Quarz
Haus Baden

Rauchquarz
Haus Baden

Smithsonit
Haus Baden

Smithsonit
Haus Baden

Wulfenit
Haus Baden

Zinkblende, Baryt
Haus Baden

Mimetesit-Kugeln
Wasserbehälter
Altemannfelsen, Feuersetzparagenese

Caledonit
Altemannfelsen

Chenit
Altemannfelsen

Elyit
Altemannfelsen

Elyit, Quarz
Altemannfelsen

Hydrocerussit
Altemannfelsen

Lanarkit, Elyit
Altemannfelsen

Lithargit, Elyit
Altemannfelsen

Minium
Altemannfelsen

Scotlandit
Altemannfelsen

Susannit
Altemannfelsen
Grube Fürstenfreude

Angliobaryt, Cerussit
Fürstenfreude

Cerussit
Fürstenfreude

Pyromorphit
Fürstenfreude

Pyromorphit
Fürstenfreude

Wulfenit
Fürstenfreude
Wilhelminenstollen, Sehringen

Anglesit-Angliobaryt
Wilhelminenstollen

Mimetesit, Cerussit
Wilhelminenstollen

Mimetesit
Wilhelminenstollen

Pyromorphit
Wilhelminenstollen

Pyromorphit
Wilhelminenstollen

Pyrargyrit
Wilhelminenstollen